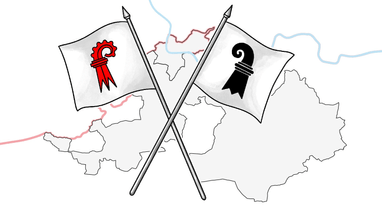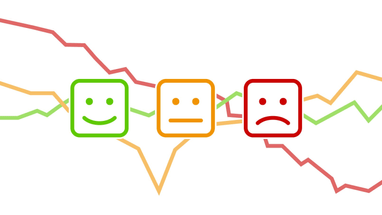Zustandsbericht Luft

Die Luftschadstoffbelastung in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft hat in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen. Zahlreiche Massnahmen haben den Ausstoss von Luftschadstoffen reduziert, je nach Schadstoff und Quellengruppe unterschiedlich stark.
Trotz der bisherigen Fortschritte kommt es zu Überschreitungen der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte bei den Stickstoffdioxiden (NO2), beim Feinstaub der Partikelgrösse kleiner als 2.5 Mikrometer (PM2.5) und beim Ozon (O3). Die Belastung mit NO2 und PM 2.5 ist überwiegend entlang der Verkehrsachsen und in städtischen Gebieten hoch. Eine Überschreitung der Ozongrenzwerte ist vor allem an heissen Sommertagen zu verzeichnen.
Zur Einhaltung der gesetzlich festgelegten Ziele (Immissionsgrenzwerte gemäss Luftreinhalte-Verordnung, Emissionsziele gemäss Luftreinhalteplanung) sind noch weitere Verbesserungen der Luftqualität notwendig. Diese müssen primär durch den konsequenten Einsatz des besten Standes der Technik erzielt werden.
Inhalte aktualisiert im Februar 2025.
Indikatoren
Ursachen
Vom Menschen verursachte Luftschadstoffe entstehen bei verschiedensten Tätigkeiten in Industrie und Gewerbe, Verkehr, Haushalten sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Häufige und gesundheitsgefährdende Luftschadstoffe sind Stickoxide (NOx), PM2.5 und Ozon. Für diese sind in der nationalen Luftreinhalte-Verordnung (LRV) Grenzwerte verankert oder es gilt aufgrund ihrer Auswirkungen das Minimierungsgebot.
Hauptursache für die Belastung der Luft mit unterschiedlichen Schadstoffen ist der Verbrauch von Energie für Verkehr und Heizungen. So stieg der Motorfahrzeugbestand zwischen 1995 und 2023 im Kanton Basel-Landschaft um rund 40 % auf gut 205‘000 Fahrzeuge an und im Kanton Basel-Stadt um 14 % auf rund 82‘000 Fahrzeuge. Um die Emissionen aus dem motorisierten Strassenverkehr weiter zu senken, sind technische und organisatorische Massnahmen notwendig.
Beim Heizen entstehen durch Verbrennung von Energieträgern (Mineralölprodukte, Kohle, Erdgas, Holz etc.) Luftschadstoffe, welche die Luftqualität beeinträchtigen. Die Entwicklung des Heizenergieverbrauchs wird im Kapitel Energie beschrieben.
Die Produktion von Gütern kann ebenfalls zu Luftbelastungen führen. Industrielle und gewerbliche Produktionsprozesse sind oft mit dem Ausstoss von Luftschadstoffen wie flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder Feinstaub verbunden. Als Indikator für die Produktion von Gütern kann das Bruttoinlandprodukt dienen, welches sich im Zeitraum von 1980 bis 2022 in beiden Kantonen mehr als verdreifacht hat.
Die Landwirtschaft stellt in erster Linie im Bereich des Luftschadstoffs Ammoniak eine wichtige Emissionsquelle dar, wobei die Emissionen in der Schweiz weitgehend auf die Nutztierhaltung zurückzuführen sind. In der Region Basel war der Rindviehbestand bis zum Jahr 2000 leicht rückläufig und hält sich seither auf einem relativ konstanten Niveau von rund 26‘000 Tieren.
Belastungen
Luftschadstoffe werden aus Kaminen von Heizungen und Verbrennungsanlagen sowie Auspuffrohren von Fahrzeugen ausgestossen. Sie entstehen auch durch das Verdunsten von Chemikalien oder durch Abrieb und Aufwirbelung.
Schadstoffe werden von Luftströmungen transportiert und können sich während ihres Transports chemisch und physikalisch verändern. So entsteht Ozon (Sommersmog) aus den Vorläuferschadstoffen Stickoxide und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Aus Ammoniak, VOC, Stickoxiden und Schwefeldioxid können sich «sekundäre» Feinstaub-Partikel bilden.
Der Ausstoss der meisten Schadstoffe ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Seit 1990 haben die Emissionen von Stickoxiden um über 70 % und diejenigen von flüchtigen organischen Verbindungen um rund 80 % abgenommen. Der Ausstoss von Feinstaub (PM10) ist im gleichen Zeitraum um rund 30 % zurückgegangen und derjenige von Feinstaub (PM2.5) um rund 35 % PM. Der Ausstoss von Ammoniak ist im gleichen Zeitraum um rund 10 % zurückgegangen [1]. Weitere Reduktionen sind bei allen Schadstoffen gemäss Luftreinhalteplan beider Basel 2024 für die nächsten Jahre vorgesehen. Dennoch braucht es einen zusätzlichen Rückgang des Schadstoffausstosses, um die lufthygienischen Ziele zu erreichen.
Zustand
Die Belastung der Luft wird in beiden Kantonen an verschiedenen Standorten gemessen [2]. Die Resultate werden anhand der Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung beurteilt. Bei den Grenzwerten wird unterschieden zwischen Jahresgrenzwerten, welche die Dauerbelastung anzeigen, und Tages- oder Stundengrenzwerten, welche die Spitzenbelastungen wiedergeben. Übermässige Luftbelastung besteht heute noch bei Stickstoffdioxid, Feinstaub PM2.5 und Ozon. Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid sowie Staubniederschlag sind heute grossräumig kein Problem mehr. Die Belastung der Luft ist geografisch unterschiedlich, je nach Schadstoff und Exposition zu den Emissionsquellen.
Bei der Luftbelastung durch Stickstoffdioxid bestehen grosse räumliche Unterschiede. Der LRV-Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter wird nur noch an verkehrsexponierten Orten wie beispielsweise entlang den Autobahnen überschritten. Die maximalen Tageswerte erreichten in den letzten Jahren nur noch in den seltensten Fällen den LRV-Tagesgrenzwert von 80 Mikrogramm pro Kubikmeter. An weniger stark verkehrsexponierten Orten in Basel-Stadt wird der Jahresgrenzwert seit einigen Jahren eingehalten: in der Agglomeration Basel seit Ende der 90er Jahre. Im ländlichen Gebiet erreichen die Messwerte weniger als die Hälfte des Jahresgrenzwertes. Seit Beginn der Messungen wird überall ein deutlicher Rückgang der Belastung beobachtet.
Neben den bereits regulierten Feinstaubpartikeln mit einem Durchmesser bis 10 Mikrometer (=PM10) wurde für Partikel mit einem Durchmesser bis 2.5 Mikrometer in der LRV im 2018 ein neuer Grenzwert eingeführt. Seit Beginn der Messungen von Feinstaub (PM10) ist die Belastung zurückgegangen. Die Dauerbelastung liegt heute an allen Standorten unter dem Grenzwert. Überschreitungen des Tagesgrenzwertes sind vor allem meteorologisch bedingt und treten im Winter während kalten, austauscharmen Tagen auf. Dann sind alle Tallagen in der Agglomeration gleichermassen von Feinstaubbelastungen betroffen. Für Feinstaub PM2.5 wurde ein Jahresgrenzwert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter festgelegt. An verkehrsexponierten Lagen wird dieser deutlich überschritten, im restlichen städtischen Gebiet leicht und in der Agglomeration sowie an den ländlichen Standorten liegt er aktuell im Bereich des Grenzwertes.
Ozon entsteht bei starker Sonneneinstrahlung aus den Vorläuferschadstoffen Stickoxide und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die chemische Umwandlung erfolgt während des Transportes der Luft mit dem Wind. Deshalb ist die Ozonbelastung im ländlichen Gebiet und am Nachmittag am höchsten und das Ausmass der Ozonbelastung stark abhängig von der Sommerwitterung. Im Jahrhundert-Hitzesommer 2003 war die Häufigkeit der Überschreitung des Stundengrenzwertes für Ozon am höchsten. In den Jurahöhen und im ländlichen Gebiet ist seit Messbeginn ein Rückgang der Ozonbelastung festzustellen. Im Siedlungsgebiet ist sie gleich geblieben. Die Ozonbelastung liegt im Sommer häufig grossräumig über den Grenzwerten.
Auswirkungen
Die Belastung der Luft mit Schadstoffen führt zu Erkrankungen des Herz-/Kreislaufsystems und der Atemwege. Die kurzfristigen Folgen starker Smog-Episoden auf die Gesundheit sind schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt: Die Zahl der Spitaleintritte aufgrund von Herz- und Lungenkrankheiten verläuft parallel zur Veränderung der Schadstoffbelastung.
Längerfristig erhöhte Schadstoffbelastungen können die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen und die Lebenserwartung verkürzen. Davon sind zum Beispiel Anwohnerinnen und Anwohner von stark verkehrsbelasteten Strassen besonders betroffen. Eine gemeinsam mit dem Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) und dem Bund entwickelte interaktive Grafik [3] ermöglicht eine Übersicht über die kurz- und langfristigen Folgen der Luftverschmutzung.
Neben den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat die Luftqualität auch einen Einfluss auf die natürlichen Ökosysteme. Infolge der übermässigen Ammoniak- und Stickoxidemissionen aus Landwirtschaft, Strassenverkehr, Feuerungen sowie Industrie und Gewerbe liegen die Stickstoffeinträge praktisch flächendeckend über der langfristig verkraftbaren ökologischen Belastungsgrenze.
Massnahmen
Durch die bisherigen Luftreinhalte-Massnahmen des Bundes und die Luftreinhaltepläne der Basler Kantone 1990 bis 2016 konnten die Luftschadstoffemissionen reduziert werden. Trotzdem werden in der Region Basel die Immissionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung für Feinstaub, Stickoxide und Ozon überschritten. Deshalb besteht nach wie vor bei allen Luftschadstoffen Handlungsbedarf.
Die Emissionsprognosen des Luftreinhalteplans beider Basel 2024 zeigen, dass bis zum Jahr 2030 die Ziellücken bei allen Stoffen in unserer Region weiter verkleinert oder sogar erreicht werden. Die Weiterführung von bereits bestehenden Massnahmen (z. B. landseitige Elektrifizierung der Liegeplätze bei der Rheinschifffahrt, Reduktion der VOC-Emissionen in Betrieben) tragen zu dieser Entwicklung bei. Der Luftreinhalteplan beider Basel 2024 sieht neue Massnahmen vor, welche zu einer weiteren Schadstoffreduktion beitragen werden [1]. Vor allem in den Bereichen Energie (insbesondere Holzfeuerungen) und Landwirtschaft (bauliche Vorgaben bei Stallbauten) sind Massnahmen vorgesehen. Zudem sollen Anträge an den Bund gestellt werden; z. B. für die rasche Einführung der EURO 7-Norm sowie für Massnahmen zur Reduktion der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft.
Aufgrund der meteorologischen Einflüsse und den grenzüberschreitenden Schadstoffverfrachtungen werden Wintersmog-Episoden und zu hohe Ozonwerte im Sommer weiterhin auftreten. Die meteorologischen Einflüsse wie auch die grenzüberschreitenden und europaweiten Schadstoffverfrachtungen bewirken Sockelbelastungen, die nur im grossräumigen Kontext zu beeinflussen sind.
Um die Luftreinhalteziele vollumfänglich zu erreichen, braucht es zusätzlich nationale Massnahmen in allen Bereichen und eine Erweiterung der internationalen Zusammenarbeit. Deshalb gewinnen die Bundesmassnahmen und internationalen Bemühungen zunehmend an Bedeutung.